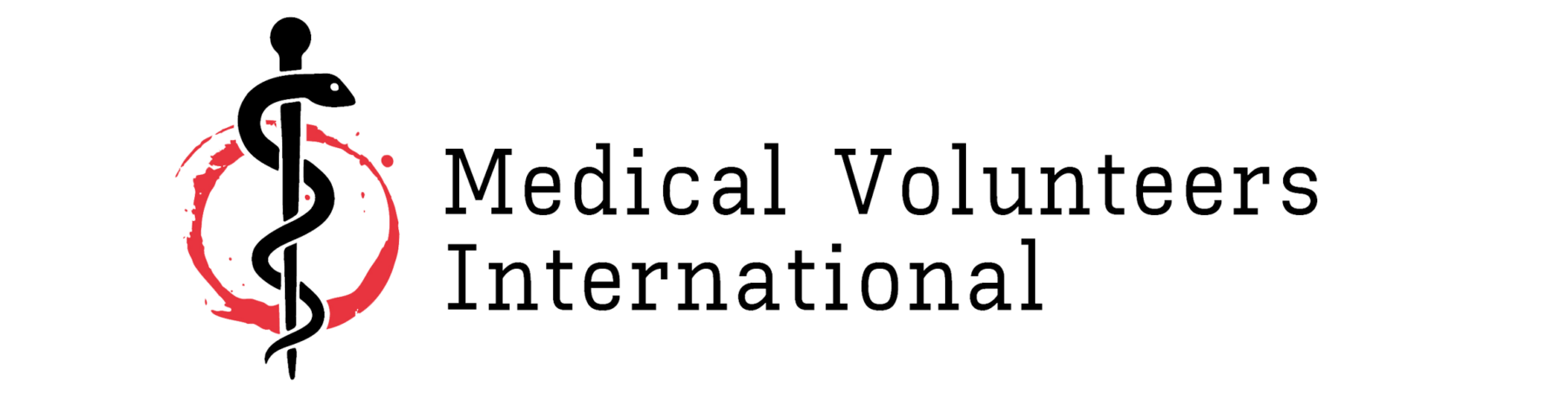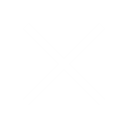Ein Jahr nach dem Brand von Moria gibt es kaum noch Aufmerksamkeit für die Menschen dort. Die Asylverfahren wurden beschleunigt – viele Geflüchtete hatten einen negativen Asylbescheid erhalten, sind nun auf griechischem Festland oder untergetaucht. Aufgrund der strikten Grenzkontrollen der Küstenwachen und “illegaler Pushbacks” kommen kaum noch Menschen auf Lesbos an.
Circa 4.000 Menschen leben aber nach wie vor im neuen Camp “Kara Tepe”, die von Medical Volunteers International allgemeinmedizinisch versorgt werden. Amar Mardini ist 31 Jahre alt, Arzt und seit Anfang Mai mit MVI auf Lesbos. Hier berichtet er über die aktuelle Situation.
Stell dich doch bitte mal kurz vor.
Mein Name ist Amar Mardini, ich bin 31 Jahre alt und von Beruf Arzt. Ich habe mein Medizinstudium in Marburg absolviert und habe seither an der dortigen Universitätsklinik in der Abteilung für Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin gearbeitet.
Wie lange bist du bereits auf Lesbos?
Ich bin seit Mai diesen Jahres hier.
Was ist deine Aufgabe vor Ort?
Ich bin als Arzt für die hausärztliche Versorgung der Geflüchteten im Camp Kara Tepe zuständig und seit kurzem zudem der zweite medizinische Koordinator der Medical Volunteers international vor Ort.
Du hast dich vermutlich auf deinen Einsatz vorbereitet und auch eingelesen.
Was hat dich bei deiner Ankunft dennoch überrascht?
Da es sich um meinen ersten Einsatz als ärztlicher Volunteer handelt, habe ich bewusst für einen Ort in Europa entschieden. Während meiner Ausbildung wurde ich vornehmlich in der Notfall- und Intensivmedizin an einer deutschen Universitätsklinik ausgebildet. Mir war bewusst, dass sich diese „High-End-Medizin“ vermutlich deutlich von den vor Ort verfügbaren Möglichkeiten unterscheidet. MVI schickt jedem neuen Volunteer vor der Ankunft einen Leitfaden zu, durch welchen man einen groben Überblick über das bekommt, was einen auf dieser Insel erwartet. Vor Ort stellt man jedoch rasch fest, dass die Herausforderungen einen sehr beanspruchen können. Einfachste diagnostische Untersuchungen und Therapien gestalten sich hier schwierig. So musste ich anfangs zu meinem Erstaunen feststellen, dass die Leitlinien der „Ärzte ohne Grenzen“, welche u.a. für Krisengebiete in Entwicklungsländern konzipiert wurden, auf europäischem Boden zum Einsatz kommen.
Was war deine Motivation einen derartigen Einsatz zu planen?
Das Thema Flüchtende, Fluchtursachen und Migration hat mich seit einigen Jahren beschäftigt. Letztes Jahr habe ich dann das Buch „Die Schande Europas: Von Flüchtlingen und Menschenrechten“ von Jean Ziegler, Vizepräsident des Beratenden Ausschusses des UN-Menschenrechtsrats, gelesen.
Ich war entsetzt über die dort beschriebenen Umstände auf der ägäischen Insel. Menschen, die vor Not und Elend flohen und während der Flucht große Strapazen auf sich nahmen, fanden sich bereits lange vor dem Brand in Moria, in einer menschenunwürdigen Lage auf europäischem Boden wieder.
Die zunehmende Akzeptanz dieser Situation auf europäischem Boden machte mich fassungslos. Es widersprach meinem Bild der Europäischen Union als eine humanitäre Gemeinschaft, welche sich den universellen und unveräußerlichen Menschenrechten verpflichtet und von so vielen Menschen auf der Welt bewundert wird. Ich wollte helfen etwas zu verändern, damit sich diese Erzählung von Europa in den späteren Geschichtsbüchern nicht nur als scheinheiliges Narrativ wiederfindet. Es waren aber auch persönliche Gründe. Mein Vater stammt ursprünglich aus Syrien. Er ist bereits Jahrzehnte vor dem Ausbruch des Bürgerkrieges nach Deutschland ausgewandert. Wenngleich mich selbst, da in Deutschland geboren und aufgewachsen, bis auf einige wundervolle Kindheits- und Jugenderinnerung während der Schulferien mit dem Herkunftsland meines Vaters wenig verbindet, so habe ich doch durch meinen Vater vermutlich einen tieferen und persönlicheren Einblick in das Leid erfahren, dass dieser verächtliche Bürgerkrieg Verwandten und Bekannten meines Vaters und den Menschen vor Ort und auf der Flucht seit nun mittlerweile einem Jahrzehnt zufügt.
Wie sieht dein „Alltag“ hier aus und wie unterscheidet sich das denn im Wesentlichen von deiner Arbeit in Deutschland?
Während mir in meiner Ausbildung an einer Universitätsklinik sämtliche diagnostische und auch therapeutische Optionen sowie eine interdisziplinäre Expertise zu jeder Zeit offen stand, muss man sich hier auf die Grundlagen einer medizinischen Untersuchung und Behandlung zurückbesinnen. Anamnese, körperliche Untersuchung und einfachste diagnostische Mittel sind alles was einem hier zur Verfügung steht. Es stellt anfangs eine ziemliche Herausforderung dar, sich wieder auf diese grundlegenden Untersuchungs- und Behandlungsmethoden einzustellen. Trotz der im Vergleich zu Deutschland jüngeren Patientenpopulation, sehen wir aufgrund der widrigen Umstände, in denen die Menschen hier leben, jeden Tag viele PatientInnen. Bauch-, Rücken und Kopfschmerzen sowie übertragbare Krankheiten wie die Krätze sind häufig. Das Lager macht krank, nicht nur körperlich. Viele der Geflüchteten benötigen aufgrund der Erfahrungen in den Heimatländern, der Flucht oder im Lager psychologische Unterstützung. Geschichten über Folter, Gewalt oder sexuelle Misshandlungen sind keine Seltenheit. Symptome einer posttraumatische Belastungsstörungen, Panikattacken bis hin zu psychogenen Krampfanfällen sind alltäglich.
Es gibt jedoch auch erfreuliche Umstände hinsichtlich der internationalen und interdisziplinären Zusammenarbeit. Der stressvolle Alltag in einer deutschen Notaufnahme ist zum Teil von einem Streit zwischen den unterschiedlichen Fachabteilungen geprägt. Der Ton zwischen ChirurgInnen und InternistInnen kann an manchen Tagen sehr rau werden. Als MVI sind wir hier vor Ort für die hausärztliche und teilweise psychologische Versorgung der PatientInnen im Camp zuständig. Wir müssen daher mit allen medizinisch tätigen Akteuren eng zusammenarbeiten. ÄrztInnen und KrankenpflegerInnen aus den verschiedensten Winkeln Europas, wie dem United Kingdom, den Niederlanden, der Schweiz, aus Portugal oder Griechenland bringen ihre unterschiedlichste Expertise in das internationale Team ein. Es wird Hand in Hand und mit einem stets offenen Ohr für Rat zusammengearbeitet. Es ist eine Bereicherung, die teils unterschiedliche Behandlungsansätze zu sehen und zu diskutieren. Für mich ist es ein hoffnungsvolles Zeichen, dass die europäische Gemeinschaft funktioniert und wir eine Lösung gemeinsam finden werden.
Gibt es Situationen im Umgang mit PatientInnen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ja, und zwar ziemlich am Anfang des Einsatzes. Ein junger Mann aus Sierra Leone stellte sich mit Kopfschmerzen vor. Ein typischer Fall im Camp, es ist heiß, das Wasser ist rationiert und die Menschen stehen unter permanentem Stress. Medizinisch kein anspruchsvoller Fall und daher eigentlich schnell zu behandeln. Da wir zu dieser Zeit gut besetzt waren, konnte ich mir jedoch Zeit für den Patienten nehmen. Ich fragte Ihn, wie alt er denn sei und wann er auf Lesbos angekommen ist. Er war 19 Jahre, allein und erst seit einigen Tagen auf der Insel. Es waren nur sehr wenige Menschen aus Sierra Leone im Camp. Er sprach Englisch, was mich freute, da wir daher keinen Übersetzer benötigten. Im Camp fand er jedoch aufgrund der nur schlechten oder mangelnden Englischkenntnisse der Geflüchteten aus anderen Herkunftsländern zum Teil schwer Anschluss. Mir ging in dem Moment durch den Kopf, wie es wohl sein muss als gerade erst erwachsen gewordener Mann nun in einem Camp mit knapp 8.000 unbekannten Menschen leben zu müssen. Ich begann mit 19 Jahren mein Medizinstudium in Marburg und um die Uhrzeit saß ich vermutlich verkatert in einer Vorlesung oder lag, nach einer langen Nacht mit Kommilitonen und neu gewonnen Freunden, noch im Bett. Auf die Frage ob er schon in Kontakt mit einer NGO für Rechtshilfe stehe, antwortete er mit „nein“. Ich zeigte Ihm daraufhin ein Papier mit Kontaktdaten der verschiedenen Rechtshilfe- Organisationen und riet Ihm möglichst umgehend rechtliche Hilfe zu suchen, am besten noch am selben Tag. Der junge Mann, der anfangs noch sehr still und skeptisch meinen Fragen zuhörte, begann nach und nach mehr zu erzählen. Die Kopfschmerzen schienen am Ende unseres Gespräches schon fast ohne Tablette verschwunden gewesen zu sein. Er bedankte sich am Ende unseres Gespräches. Seit Beginn seiner Flucht habe er wenig Hilfe von fremden Menschen bekommen, erzählte er beim Verlassen des Raumes. Er folgte meinen Rat und fand noch vor seinem ersten Interview mit den Behörden eine Organisation, welche Ihn in der Rechtshilfe berät. Er schaut weiterhin ab und an in der Klinik vorbei und erzählt mir das Neuste aus seinem Fall. Die Chancen für eine positive Entscheidung stehen nicht schlecht. Schmerztabletten wegen Kopfschmerzen hat er nur noch einmal benötigt.
Wie würdest du die aktuelle Lage der Geflüchteten auf der Insel beschreiben?
Als Arzt vermag ich keinen gesamten Überblick über die aktuelle Lage der Geflüchteten abgeben zu können. Aus medizinischer Sicht handelt es sich nach wie vor um eine sehr prekäre Lage. Obwohl auf europäischen Boden angekommen, ist es nicht möglich, die PatientInnen gemäß medizinischer Leitlinien zu behandeln. Es sind PatientInnen zweiter Klasse. Insbesondere durch die Covid-19-Pandemie stehen uns nur wenig diagnostische Mittel zur Verfügung. Das örtliche Krankenhaus erlaubt nur noch Notfälle, für Termine bei SpezialistInnen warten PatientInnen mehrere Monate. In manchen Fällen sogar, obwohl man als behandelnder Arzt eine abwendbare Ursache der Krankheit vermutet und fürchtet, dass bis zur Abklärung durch die SpezialistInnen die Situation weiter verschlechtern wird oder gar irreversibel geworden ist. Die Schuld allein bei den griechischen Behörden zu suchen ist jedoch falsch. Das Gesundheitssystem in Griechenland war bereits vor 2015 im Zuge der Finanzkrise deutlich strapaziert. Die Versorgung der Tausenden an Geflüchteten ist für ein Gesundheitssystem wie dieses nicht möglich. Es bedarf rasch vor Ort an internationaler Hilfe mit ExpertInnen und SpezialistInnen aus der europäischen Gemeinschaft, um die Lage der Geflüchteten zu ändern.
Wie hat sich das seit deiner Ankunft verändert?
Als ich den Einsatz auf Lesbos begonnen habe, waren noch knapp 8.000 Menschen im Camp. Mittler- weile sind es deutlich weniger geworden. Für die noch verbliebenen Geflüchteten ist die Situation aussichtsloser geworden. Die meisten haben bereits eine oder zwei Ablehnung ihres Asylverfahrens erhalten, manche sogar schon vier. Die Verzweiflung der Menschen hat zugenommen. Nach einer großen Welle an Ablehnungen und der Androhung auf Abschiebung von der offiziellen Regierungs- behörde sahen wir einen deutlichen Anstieg an Suizidversuchen, teilweise Fälle von erweitertem Suizid von verzweifelten Elternteilen mit Kindern. Es schaffen nur noch wenige Geflüchtete den gefährlichen Wasserweg aus der Türkei nach Griechenland zu überwinden. Durch die illegalen und unmenschlichen Push-back-Methoden, welche sich dank Organisationen wie „Aegean Boat Report“ auf den sozialen Medien wie Facebook gut verfolgen lassen, ist selbst die Ankunft auf der Insel keine Garantie mehr für ein faires Asylverfahren. Männer, Frauen und Kinder werden, obwohl auf europäischen Boden angekommen, wieder auf Schlauchboote vor die türkische Küste gesetzt.
Was können Menschen in Deutschland machen, um zu unterstützen?
Nach dem Feuer in dem alten Camp „Moria“ auf Lesbos kam es zu einer größeren Spendenbereitschaft. Die Lage auf der ägäischen Insel mag sich seit dem Brand etwas geändert haben, jedoch sind die Menschen nicht einfach verschwunden. Zehntausende Menschen sitzen nach wie vor, ohne legale Möglichkeit für Nahrung oder medizinischen Versorgung, in Griechenland fest. Für viele sind die in Griechenland tätigen NGOs die einzige Möglichkeit, um die notwendigsten Dinge des Lebens zu erhalten. Es sollte nicht erst wieder eine große Tragödie passieren müssen, um den Leuten in der Heimat die dramatische Lage vor Ort in das Gedächtnis zu rufen.
Was würdest du dir wünschen? Was sollte sich hier in Griechenland bzw. in Europa verändern?
Zunächst müssen die illegalen und menschenrechtsverletzenden Push-back-Methoden umgehend ein Ende finden. Die Problematik von Geflüchteten und Migration wird national nicht bewältigbar sein. Die Europäischen Union muss sich endlich der Verantwortung stellen. Menschenrechte, im wahrsten Sinne des Wortes über Bord zu werfen, darf nicht die Antwort sein. Die Notwendigkeit von so zahlreichen Nichtregierungsorganisationen auf europäischen Boden, um ein Minimum an Menschenwürde aufrecht zu erhalten ist eine Schande für eine internationale Gemeinschaft wie die Europäische Union. Aufgrund politischen Druckes war es möglich in kürzester Zeit eine neue Grenzkontroll-Organisation zu gründen. Es muss daher ebenfalls möglich sein eine europäische Organisation zur Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung an den Grenzen der Union zu gründen. Finanzielle Unterstützung allein wird Ländern wie Spanien, Italien oder Griechenland nicht helfen um mit den zunehmenden menschlichen Dramen, die sich an unseren Grenzen abspielen, fertig zu werden. Es benötigt Menschen mit Expertise vor Ort. Ich bin mir sicher, dass zahlreiche KrankenpflegerInnen und ÄrztInnen bereit dazu bereit wären. Sie machen es bereits freiwillig in Ihren wohlverdienten Urlauben und mit Ihrem angesparten Geld.
Worüber wird deiner Ansicht nach zu wenig berichtet?
Von den einzelnen Menschen, die sich auf die Flucht begeben mussten. Durch Framing-Wörter wie Flüchtlingswelle verschwindet das Schicksal des Einzelnen häufig in einer bedrohlich wirkenden Naturgewalt. Durch die Arbeit in der Klinik im Camp, insbesondere durch die zahlreichen Gespräche mit den ÜbersetzerInnen mit denen wir tagtäglich mehrere Stunden in einem Raum verbringen, verschwinden die Unterschiede des vermeintlich Fremden rasch und es zeigen sich die vielen Gemeinsamkeiten. Junge Männer und Frauen, die vor der Flucht studiert haben oder als KrankenpflegerIn oder Handwerker ihren Lebensunterhalt verdient haben und dabei waren sich ein Leben aufzubauen sind nun nicht nur Ihrer Heimat beraubt worden. Sie sind mittlerweile zu Gefangenen auf europäischem Boden geworden, oft ohne Aussicht auf Hoffnung. Vor den Augen dem sehnsüchtig herbeigewünschten Europa so nah, bleibt es unerreichbar für die meisten der Geflüchteten. Und beim Blick zurück, entfaltet sich das Bild des brennenden Heimatlandes, was aus aktuellem Anlass selbst der internationalen Presse nicht entgeht.
Vielen Dank für das Gespräch.