“Das klingt vielleicht bizarr: Aber gegen das, was ich hier erlebe, war Lesbos für mich als freiwillig mitarbeitender Arzt fast wie Urlaub.”
Leonard Kirn studierte in Berlin Medizin und macht derzeit eine Facharztausbildung zum Anästhesisten und Intensivmediziner. Schon während des Studiums fasste er den Entschluss, eines Tages in der humanitären Hilfe mitzuwirken. Ihn beschäftigte die Situation der Geflüchteten, weshalb er entschied, sich ein eigenes Bild von der Lage vor Ort machen zu wollen. Im März war er bereits mit MVI in Athen. Die Erfahrungen, die er dort machte, haben ihn inspiriert und motiviert, im Herbst 2021 wieder in einem MVI Projekt zu unterstützen.
Du warst nun mehrere Wochen als Arzt auf Lesbos, bevor du relativ spontan nach Bosnien gingst. Wie kam es zu dem Ortswechsel?
Auf Lesbos hat sich die Situation in den letzten Monaten verändert: Es kommen kaum noch Geflüchtete an und einige verlassen das Camp, sodass heute “nur noch” rund Zweitausend Geflüchtete aus Lesbos sind – während das Netz an medizinischen Hilfsangeboten durch Nichtregierungsorganisationen (NGOs) relativ stabil geblieben ist. Das bedeutet, dass nicht mehr so viele Ärzt*innen gebraucht werden wie früher. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass sich die Situation in Bosnien zuspitzt, wo es deutlich weniger medizinische Hilfe für Geflüchtete gibt – diese aber dringend gebraucht wird. Unser Vorteil als kleine, dynamische Organisation, ist: Wir können schnell agieren und unsere Arbeit auf die aktuelle Situation anpassen. In diesem Fall wurde ich quasi versetzt und bin mit Fähre und Bus von Lesbos aufgebrochen und wenige Tage später in Velika Kladusa, Bosnien, angekommen.
Wie waren für dich die Eindrücke der ersten Tage in Bosnien?
Das klingt vielleicht bizarr: Aber gegen das, was ich hier erlebe, war Lesbos für mich als freiwillig mitarbeitender Arzt fast wie Urlaub. Auf Lesbos gibt es Bars, Strände und einfach Ablenkung. Hier zu arbeiten ist etwas anderes. Die mentale Belastung ist hoch. Die Stadt ist ein sehr trostloser Ort. Es ist kalt und karg. Ich bin eigentlich ein sehr aktiver Mensch, aber hier muss ich mich überwinden, überhaupt rauszugehen.
Velika Kladusa liegt an der Grenze zu Kroatien und damit zur EU-Außengrenze. Überall sieht man die Spuren des Kriegs. Zerbombte Häuser und Ruinen. Anders als auf Lesbos, wo die Geflüchteten in eine Umgebung kommen, wo die Mehrheit der Einheimischen in relativem Wohlstand lebt, sieht man hier überall Armut – nicht nur bei den Geflüchteten. Aber sie trifft es natürlich besonders: Sie leben meist in leerstehenden Häusern und Baracken ohne Strom und Heizung. Sie wärmen sich mit Decken und machen selbst Feuer, um sich warm zu halten. Das ist im Winter, bei teilweise -6 Grad, echt hart. Vor allem wenn man die Kinder hier sieht, das zerreißt mir das Herz. Wenn man dann daran denkt, wie einige Kinder in Deutschland in der Vorweihnachtszeit durchgefüttert werden, ist der Kontrast noch krasser.
Mit wie viel Mitarbeiter*innen seid ihr derzeit im Einsatz?
Momentan haben wir hier nur ein Team bestehend aus der Projektkoordinatorin, einer Krankenschwester und mir als Arzt. Wir haben eigentlich rund um die Uhr Rufbereitschaft. Bei Notfällen fahren wir auch um Mitternacht noch raus. Das verlangt einem schon einiges ab. Aber die Registrierung für die Arbeit in Bosnien hat MVI erst vor kurzem bekommen. Anders als auf Lesbos ist es hier für NGOs zum Teil gefährlicher und schwieriger zu arbeiten. Von Teilen der Gesellschaft und der Polizei ist unsere Arbeit nicht immer gern gesehen. Deshalb arbeiten wir möglichst verdeckt.
Anders als auf Lesbos haben wir hier keine Klinik, sondern versuchen uns wie Touristen zu verhalten. Die Patient*innen besuchen wir mit einem Wanderrucksack voller Medikamente. Wir haben auch ein Auto, mit denen wir einige Fahrten machen. Die Geflüchteten schicken uns über Facebook einen Standort, wenn sie medizinische Hilfe brauchen.
Wie muss man sich die Situation vor Ort vorstellen: Wie sieht das Leben der Geflüchteten aus?
Velika Kladusa ist für viele der letzte Halt vor der EU-Grenze. Eine Stadt, in der sie bleiben und auf den richtigen Moment warten, um wieder einen Versuch über die Grenze zu wagen. Sie nennen die Überquerung der Grenze “The Game”. Das klingt in meinen Ohren etwas irritierend. Aber gemeint ist damit wohl das Spiel mit dem Risiko, das man in Kauf nimmt – man weiß nie, ob man es schafft oder nicht. Viele versuchen es mit dem Bus oder mit der Hilfe von Schmugglern. Wenn sie erwischt werden, nehmen die Grenzbeamten oder Polizist*innen ihnen Handys, Powerbanks und andere Gegenstände weg. Diese werden zerstört und die Geflüchteten irgendwo auf der anderen Seite der Grenze wieder ausgesetzt. Viele kommen nach einem gescheiterten Versuch dann wieder zurück nach Velika Kladusa, bekommen durch die Hilfe von NGOs wieder das nötigste zum Leben – und versuchen es dann wieder von vorne. Wir können die Politik nicht ändern. Aber wir können versuchen, den Geflüchteten die nötigste medizinische Versorgung anzubieten.
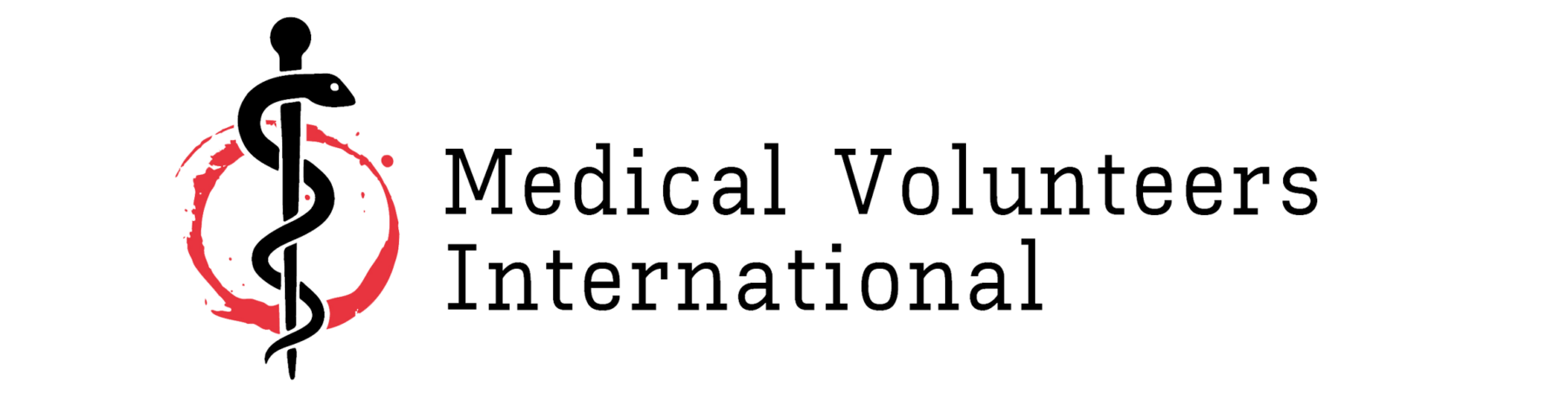


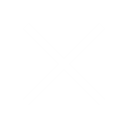
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!